Nicht nur Hunde beißen
In meinen Erinnerungen sehe ich riesige Schneemassen, die sich Ende November 1959 vor dem schmucken Einfamilienhaus türmen. Auf mich kesse Dreijährige wirkt auch das Haus sehr groß.
„Du musst immer an der Wand entlang die Treppe rauf und runtergehen“, höre ich die Stimme meines Vaters x-mal sagen. Das Treppengeländer fehlt noch, es ist in Arbeit; der Nachbar und Freund meines Vater hat ebenfalls gerade ein Haus erbaut und nun waren die Feinarbeiten dran- dazu zählte auch das Treppengeländer.
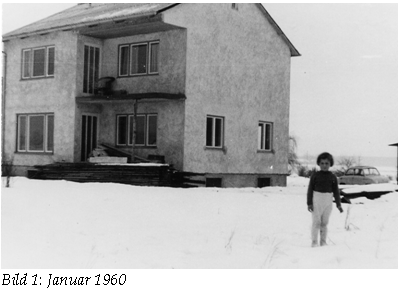 Es
dauerte nicht lange und ich lernte die Nachbarskinder, die südlich unseres
Hauses leben, kennen. Zwei Schwestern, die ein, bzw. zwei Jahre älter als wie
ich sind und deren Bruder, der ein Jahr jünger ist: Margit, Birgit und Toni.
Sie sind meine ersten Freunde und wir spielten ganze Nachmittage im Esszimmer
der Familie. Die Mutter stellte uns mehr oder weniger bereitwillig ihre
Garderobe zur Verfügung, darunter die schneeweißen Brautschuhe. Wir spielten
„Königinnen“. Die Mutter meiner Freunde erzählte uns von den Königinnen und
Prinzessinnen, was sie aus den bunten Illustrierten, die damals in Massen auf
den Markt kamen, wusste. Was sich da alles tat in den Königshäusern erstaunte
mich doch sehr. Soraya, die wunderschöne blutjunge Königin im fernen Persien,
war verstoßen worden, sie beherrschte damals die Gazetten, wie später Grace
Kelly, Jackie Kennedy und Diana, Prinzess of Wales. „Nein, die Belgische
Königin will ich nicht sein“, beschwerte sich Margit, „die kann doch auch keine
Kinder bekommen“. Wir Mädchen schlüpften für Stunden in die Rollen der Großen
und Schönen, in unseren Kinderaugen so zauberhaften Mitglieder der Adelshäuser.
Es
dauerte nicht lange und ich lernte die Nachbarskinder, die südlich unseres
Hauses leben, kennen. Zwei Schwestern, die ein, bzw. zwei Jahre älter als wie
ich sind und deren Bruder, der ein Jahr jünger ist: Margit, Birgit und Toni.
Sie sind meine ersten Freunde und wir spielten ganze Nachmittage im Esszimmer
der Familie. Die Mutter stellte uns mehr oder weniger bereitwillig ihre
Garderobe zur Verfügung, darunter die schneeweißen Brautschuhe. Wir spielten
„Königinnen“. Die Mutter meiner Freunde erzählte uns von den Königinnen und
Prinzessinnen, was sie aus den bunten Illustrierten, die damals in Massen auf
den Markt kamen, wusste. Was sich da alles tat in den Königshäusern erstaunte
mich doch sehr. Soraya, die wunderschöne blutjunge Königin im fernen Persien,
war verstoßen worden, sie beherrschte damals die Gazetten, wie später Grace
Kelly, Jackie Kennedy und Diana, Prinzess of Wales. „Nein, die Belgische
Königin will ich nicht sein“, beschwerte sich Margit, „die kann doch auch keine
Kinder bekommen“. Wir Mädchen schlüpften für Stunden in die Rollen der Großen
und Schönen, in unseren Kinderaugen so zauberhaften Mitglieder der Adelshäuser.
 In späteren Jahren spielten wir mit Hingabe
„Monopoly“, „Mensch ärgere dich nicht“ und viele lustige Kartenspiele. Jedoch,
auch hier sei erwähnt, dass wir stundenlang im riesigen Garten spielten. Wir
kannten alle Spiele, die ganz einfachen: Kaiser, wieviel Schritte darf ich
gehen?, Ratespiele, Blinde Kuh, Dreh dich nicht um, der Fuchs geht um......
In späteren Jahren spielten wir mit Hingabe
„Monopoly“, „Mensch ärgere dich nicht“ und viele lustige Kartenspiele. Jedoch,
auch hier sei erwähnt, dass wir stundenlang im riesigen Garten spielten. Wir
kannten alle Spiele, die ganz einfachen: Kaiser, wieviel Schritte darf ich
gehen?, Ratespiele, Blinde Kuh, Dreh dich nicht um, der Fuchs geht um......
„In den Kindergarten gehe ich nicht“, plärrte ich mit Nachdruck. Meine Mutter war ratlos, hilflos und sicher auch wütend. Gerade hatte ich die Kindergärtnerin recht kräftig in den Daumen gebissen. Schnellentschlossen verließ meine Mutter mit feuerrotem Kopf und mir an der Hand den Kindergarten. Am Abend und auch am anderen Morgen redete mir mein Vater gut zu, in den Kindergarten zu gehen. Ich nickte und glaubte an mich. Als ich mich an der Hand meiner Mutter dem Gebäude näherte, beschlich mich wieder diese unerklärliche Angst und die Tränen rannen mir über die Wangen. Genau erinnerte ich mich an das Versprechen, das ich meinem Vater gegeben hatte. Ich wollte ihn nicht enttäuschen, keinesfalls. Noch heute höre ich die Türglocke, die mir später so vertraut wurde. Diese Glocke verbreitete einen angenehmen Ton, nicht so schrill wie in späteren Jahren die Schulglocke. Jedoch, es half nichts und damals stellte die Glocke keinen vertrauten Ton für mich dar. Mein Herz sank in die Hosentasche; ich roch sehr intensiv das Leder, das die brauen Kindergartentäschchen verbreiteten. Gepaart mit Obst, Wurst und Brotgerüchen empfand ich diesen Geruch doch sehr abstoßend.
Jeder gute Vorsatz in mir war spätestens dahin, als sich die große, schlanke, ganz in schwarz gekleidete Gestalt im Türrahmen umdrehte: „Ja, wen haben wir denn da?“, fragte die junge, hübsche Nonne und sie hatte eine sehr sympathische Stimme. Trotzdem, ich wollte weg, heim! Tags zuvor hatte ich eine andere Kindergärtnerin, nämlich Fräulein Dobmeier in den Daumen gebissen und die hatte ich nun erwartet. In jener Zeit war in Anzing ein steter Wechsel des Personals und die Pfarrei erwartete, dass Fräulein Dobmeier blieb- sie tat es, das wussten wir aber zu dem Zeitpunkt noch nicht.
Auf mich wirkte die Nonne furchteinflößend und eh sich meine Mutter und die junge, angehende Kindergärtnerin versahen, suchte ich das Weite. Zuhause angelangt öffnete mir meine Großmutter erstaunlich schnell die Haustüre, vermutlich hatte sie mich schon erwartet.
Am anderen Morgen brachte mich mein Vater in den Kindergarten, das überraschte mich.
„Jetzt will ich doch mal sehen, warum du da nicht bleiben willst“, sagte er und vertiefte sich in ein Gespräch mit der Kindergärtnerin. Interessiert wandte ich mich den Kindern im Raum zu. An diesem Tag wagte ich die ersten Schritte in die Gruppe, ich beteiligte mich am Spiel, bei den Bastelarbeiten, hörte Fräulein Dobmeier zu und war überrascht, was sie nicht alles konnte und wusste.
„Warum kommst du und dein Bruder mit dem Auto in den Kindergarten?“, fragte ich die weizenblonde Dora. Die Haarfarbe faszinierte mich und das ruhige Mädchen mochte ich vom ersten Augenblick an. „Wir wohnen nicht in Anzing, sondern in Ranharting“, erklärte sie mir. Wenn wir im Kindergarten malten, suchte ich immer nach dem Stift, der der blonden Haarfarbe von Dora entsprach. Jedoch, ich konnte ihn nie finden. „Du musst gelb nehmen“, sagte Fräulein Dobmeier. „Gelb“ wollte ich nicht, das kam für mich nicht Frage. So kam es, dass manche Mädchen, die ich malte, keine Haare auf dem Kopf hatten, was mir natürlich Gelächter und Gespött eintrug und meine Lust am Malen deutlich dämpfte! Bald sollte ich den schönen Bauernhof kennenlernen, auf dem Dora mit ihrer Familie wohnte. Seit dieser Begegnung die im Kindergarten in Anzing begann, holten meine Eltern jahrelang Eier frisch vom Hof und ab zu ein Suppenhuhn.
Auf meinem täglichen kurzen Weg in den Kindergarten traf ich öfter auf zwei Buben, die den gleichen Weg hatten: Lenze und Anderl; Anderl war so alt wie ich, Lenze ein paar Jahre älter.
Wir sollten alle einige Jahre später wieder einen großen Raum miteinander teilen: Das Sechstklass-Klassenzimmer, mit der Blumenvase auf dem Vierertisch!
An einem schönen Morgen betraten die Brüder und ich gemeinsam den Garderobenraum des Kindergartens. „Ich bleibe nicht hier“, sagte Lenze mit gedämpfter Stimme, sprachs und verschwand mit einem gekonnten Sprung aus dem Fenster. Anderl setzte seinem Bruder sofort hinterher und irgendwie fühlte ich mich verpflichtet, es den beiden gleich zu tun. Als ich aus dem Fenster geklettert war, fand ich mich zu Füssen des Busfahrers, der die Poinger Kinder mit dem VW-Bus brachte, wieder. Dieser hatte gerade den Bus geparkt und er bewachte die Ankunft der Schützlinge. Poing hatte zu dieser Zeit noch keinen Kindergarten. Die beiden flotten Buben konnte der freundliche Mann nicht mehr einfangen, aber mich brachte er sofort zurück.
Obwohl es mir grundsätzlich im Kindergarten gut gefiel, hatte ich eine gewisse Lust am Ausbüchsen gefunden. Den weitläufigen Garten, der zur Einrichtung gehörte, trennte ein hohes, weißes, schmiedeeisenes Tor von einem schmalen Weg, der auf die Straße führte. Heutzutage ist es undenkbar, solch ein Tor, mit nach oben geöffneten Spitzen in ein Kindergartengelände einzubauen.
Für mich stellte dieses Tor eine gewisse Herausforderung dar. Mit meiner Freundin Susi, einem robusten Mädchen, wagte ich wenige Tage später erneut, auszubüchsen.
Susi war in jenen, längst vergangenen Tagen nicht so sportlich wie ich und hatte enorme Probleme, das wunderschöne, aber sehr hohe Tor zu überwinden. Ich schob und stützte sie ab und mit vereinten Kräften schafften wir es und machten uns zielsicher auf den Weg zu ihrem Elternhaus.
Susi wohnte mit ihren Eltern in einem uralten Bauernhof, der Betrieb war damals schon eingestellt. Es handelte sich um ein Haus, das wie ein Märchenhaus anmutete. Das Wohnhaus war sehr klein und niedrig, in der direkt angebauten Tenne wurden alte Möbel und andere Gerätschaften aufbewahrt. Das Waschhaus war ein eigenes kleines Haus und die Toilette war ein Plumpsklo, was mir recht gut gefiel. Plumpsklos kannte ich von den Bergwanderungen, die ich als Kind vielfach mit meinen Eltern unternahm.
Das Wohnhaus lag in der Mitte eines sehr großen, mit uralten Bäumen eingewachsenen Grundstückes. Alles mutete nach einer verwunschenen Märchenlandschaft an und selbst als Kind spürte ich einen Zauber, der von dem gesamten Anwesen ausging. Die mehreren tausend Quadratmeter waren eingezäunt und ein schmiedeeisenes Tor, das sich quietschend öffnen ließ, bildete den passenden Eingang zu dem herrlichen Anwesen. Über einen gepflasterten, leicht ansteigenden Weg erreichte man die niedrige, durch ein Fliegengitter geschützte Haustüre. Rechts, parallel zum Weg hatte die Mutter meiner Freundin eine Gemüse und Blumenplantage angelegt, die ihresgleichen in Anzing suchte. Es blühte und wuchs in diesen Beeten, vom Frühling bis zum Winter. Alles, was man sich vorstellen kann, von Krautköpfen bis hin zu Kartoffeln, Tomaten, Paprika, Kräuter und alle Arten von Gewürzen gedieh wie von Zauberhand gezogen in diesem Paradies.
Die Mutter meiner Freundin kam durch die Kriegswirren und durch persönliche Schicksalsschläge vom damaligen Jugoslawien nach München und später heiratete sie nach Anzing.
Sie lebte ca 20 Jahre in dem Dorf und prägte dem Anwesen ihren Stempel auf. An Susis Vater habe ich lediglich eine ganz vage Erinnerung, er verstarb als wir in den ersten Volksschuljahren waren.
So lebte die resolute und oft auch impulsive Witwe mit meiner temperamentvollen Freundin in der verwunschenen Märchenlandschaft. Links des Eingangsweges standen einige alte, ehrfurchteinflößende Bäume, zu denen meine Freundin bereits in sehr jungen Jahren eine enge Beziehung entwickelte.
„Ihnen habe ich als erstes anvertraut, dass ich schwanger bin“, erzählte mir Susi Jahrzehnte später.
Im Schutz dieser knorrigen Bäume und deren Äste stand eine hölzerne, geräumige Laube; - von meiner Freundin in Jugendjahren oft als Liebeslaube genutzt. Vor meinem geistigen Auge sehe ich noch heute die liebliche Anordnung der Gebäude, sehe die alten Bäume im Sonnenlicht stehen, den runden, ganz aus Holz erbauten Liebespavillon.
Hinter dem Haus, ganz am Ortsausgang befand sich ein dicht bewachsener Nadelwald, auf einigen tausend Quadratmetern. Das komplette Anwesen stellte ein Traum-Spielgelände für uns Kinder dar.
Der Wald, mit seinem kleinen Weg, den wir nur kriechend „begehen“ konnten, bot uns Schutz in den heißen Sommern unserer Kindheit. Dort heckten wir „Räuberpistolen“ aus, die Landschaft hierfür hatten wir buchstäblich vor der Nase liegen. Das Gehölz stand so dicht, dass es uns bei Regen ein Dach formte. Heute ist das Haus mit den Nebengebäuden und dem Wald verschwunden.
Die Nachbarhäuser, das Benefiziatenhaus und ein Bauernhof stehen noch und geben ein stummes Zeugnis der verlorenen Idylle.
Vor 46 Jahren, als wir beide Dreikäsehoch nach dem erfolgreichen Ausbruch aus dem Kindergarten auf das alte Bauernhaus zusteuerten, ahnten wir nicht im Geringsten, was in den kommenden Jahrzehnten an Veränderungen in Anzing, dem alten Straßendorf, vollzogen wird.
Susis Mutter stand, so wie sie immer stand, am Küchenfenster. Vor ihr eine riesige Schüssel auf dem Küchentisch, darin hantierte sie. Sie war eine Meisterin im Einkochen, backen, eine Küchenmeisterin in allem.
Sie ließ uns eintreten und ich spiegelte mich in ihren Brillengläsern. Sofort stellte sie uns die Frage: „Warum kommt ihr jetzt schon? Wissen deine Eltern überhaupt, dass du hier bist?“. Wir beide zogen den Kopf ein, wir hatten Respekt vor der kleinen Frau. Susis Mutter sah genervt auf die Uhr, packte uns an den Handgelenken und machte sich mit uns auf den Weg Richtung Kindergarten.
Was sie mit der Kindergärtnerin konkret besprach, weiß ich nicht mehr. Kurz darauf klingelten wir an der Haustüre meines Elternhauses und meine verdutzte Mutter nahm mich in Empfang: „ Heute bleibst du hier, morgen kannst du zu Susi gehen“, ich fügte mich und freute mich.
Zu Susi gehen verhieß Abenteuer erleben, wir beide hatten Fantasie; uns reichte die frische Luft und Wasser. Hinter dem Wald entspringt die Sempt; an dem Rinnsal, das die Sempt in Anzing darstellt, gab es immer viel zu entdecken. Im Sommer war es angenehm kühl im Bacherl, im Frühling und Herbst stiegen wir mit Gummistiefeln in das erfrischende Nass.
„Wollt ihr ein Butterbrot?“, Susis Mutter stand mit dicken Broten, darauf auch noch Schnittlauch vor uns. „Danke“, das selbst gebackene Brot und die süße Limonade schmeckten köstlich.
„Ihr kommt bald in die Schule“, eröffnete uns Fräulein Dobmeier, was wir natürlich selbst schon wussten. Sie war eine erfahrene Kindergärtnerin, die wir Kinder achteten und deren Anordnungen wir befolgten. Wir waren etwa 40 Kinder tagtäglich und hatten alters entsprechend unterschiedliche Interessen und Anforderungen unsererseits an die Erzieherin. Ich wusste, dass ich zu den Schulanfängerinnen zählte und war stolz darauf. Dass wir viele, also ein geburtenstarker Jahrgang waren, stellte die Erst und Zweitklasslehrerin, Roswitha Wahler, vor eine große Aufgabe. Ich kann mich noch erinnern, dass Roswitha Wahler manchmal am Nachmittag zu uns in den Kindergarten kam und mit Fräulein Dobmeier Gespräche führte. Beide nahmen uns Kinder in Augenschein und wir alle spürten, dass Veränderungen im Raum standen.
Nun stand aber erst unser „Abschiedsfest“ auf dem Programm. Fräulein Dobmeier kannte jedes Märchen, jedes Lied, konnte falten, kleben, basteln, ich war mir sicher, dass es ein besonders schönes Fest geben wird. „Evi und Siegfried, kommt einmal her“, kurz und knapp erklärte sie uns, dass auf dem Zettel, den jeder von uns in Händen hielt, ein Gedicht steht. „Gebt es bitte euren Eltern und lernt jeden Tag fleißig“, gab sie uns mit auf den Nachhauseweg. Ich kann den Inhalt des Gedichtes leider nicht wieder geben und habe es nirgendwo gefunden. Vielleicht hat sie es selbst geschrieben – ich kann sie leider nicht mehr fragen, sie ist schon seit vielen Jahren gestorben. Der Inhalt des Gedichtes handelte von etwas unendlich wertvollem, das im Garten zu finden sei. Des Rätsels Lösung ist ein Stein, der bei der Gartenarbeit in einem Beet gefunden wird. Keine Frage, Sigi und ich übten fleißig zuhause und auch im Kindergarten, es war uns eine Ehre, das Gedicht vortragen zu dürfen.
Am Festabend waren wir natürlich sehr aufgeregt und voll Freude. Die Eltern saßen im Kreis und freuten sich mit uns, denn nun begann ein völlig neuer Lebensabschnitt. Auch die Erst und Zweitklasslehrerin befand sich unter den Gästen und ich hatte den Eindruck, ihre klaren blauen Augen sind auf mich gerichtet.
 Fräulein
Dobmeier verstand es hervorragend, uns auf Feste und Feiern, auf die jeweiligen
Festtage einzustimmen. Bald wussten wir um all die Geschehnisse, die sich im
Laufes eines Jahres, auch eines Kirchenjahres abspielen.
Fräulein
Dobmeier verstand es hervorragend, uns auf Feste und Feiern, auf die jeweiligen
Festtage einzustimmen. Bald wussten wir um all die Geschehnisse, die sich im
Laufes eines Jahres, auch eines Kirchenjahres abspielen.
Im Kindergartenalter glaubten wir alle felsenfest an die Existenz des Nikolaus und seines treuen Begleiters, Knecht Ruprecht und dass sie einmal im Jahr den Menschen einen Besuch abstatten.
Traditionell besuchen der Nikolaus und sein Knecht die Kinder am Vorabend seines Namenstages, also am 05. Dezember. Da es aber so viele Kinder seien, so erklärte man uns, müssen der Nikolaus und Knecht Ruprecht auch am 06.12. und vielleicht sogar noch ein paar Abende später die Kinder besuchen. „Mich braucht er nicht besuchen“, ließ sich Lenze vernehmen. „Aha“ sagte Fräulein Dobmeier „hast wohl Angst ?“ Feuerrot lief der forsche Gärtnerjunge an und zog es vor zu schweigen. Jedenfalls kann ich mich nicht erinnern, die beiden Gärtnerjungen an dem Tag, als der Nikolaus in den Anzinger Kindergarten kam, gesehen zu haben.
„Heute kommt der Nikolaus!“, verhaltene Freude machte sich in mir breit. Wusste ich nur zu gut, dass der Nikolaus übers Jahr akribisch ein goldenes Buch beschreibt und darin alle guten, aber leider auch schlechten Taten aufgeschrieben sind. „Der Nikolaus weiß, dass du heute nicht brav bist“, diesen Satz bekam ich öfter von meiner Großmutter zu hören. Ich überlegte fieberhaft, wie oft sie das wohl übers Jahr zu mir gesagt hat. Ich wusste aber auch, dass der Nikolaus Geschenke verteilt. Knecht Ruprecht hat einen großen Sack dabei und darin sind die Geschenke. Es kann aber auch sein, dass er Kinder mitnimmt – das war mir unheimlich. Aber, meine Großmutter hat mir auch gesagt, nur die bösen Buben kämen in den Sack und recht weit würde der Knecht Ruprecht die Buben nicht schleppen. Trotzdem, ich fragte zur Sicherheit Fräulein Dobmeier und die lächelte und sagte, sie hätte noch nie erlebt, dass der Knecht Ruprecht Buben mitgenommen hat. Ich war beruhigt; nicht auszudenken, wenn mich der Knecht des Heiligen Mannes verschleppt und irgendwo, vielleicht im Ebersberger Forst, bei Nacht, Kälte und Schnee aussetzt.
Als es dann so weit war, die Adventkerzen brannten und verströmten einen Geruch, den „Geruch des Himmels“, wie unsere Kindergärtnerin sagte, sangen wir traditionelle Nikolauslieder -wir kannten sie alle.
Gerade, als wir im großen Kreis, immerhin erwarteten ca 40 Kinder den Besuch des himmlischen Boten, das Gedicht aufsagen, hören wir ein Kettenrasseln und an die Türe, die zum Garten führt, wurde gepoltert. Augenblicklich verstummten wir und ich traute meinen Augen nicht, so manch einem Buben kullerten Tränen über´s rote Gesicht. Die Türe öffnete sich und der Nikolaus musste sich bücken, damit er mit der hohen Bischofsmütze den Raum betreten konnte. Wir staunten über das prächtige rote Gewand, die schneeweißen Handschuhe und der glutrote Ring funkelte.
Hinter ihm betrat der Knecht, der einen groben Rupfensack trug und eine Pelzmütze die sein Gesicht fast verdeckte, den Raum. Wir alle waren beeindruckt; an den Stiefeln klebten Schneereste und eine romantische, fast vertraute Atmosphäre machte sich breit. Fräulein Dobmeier begrüßte die beiden und wir sangen alle: „Lasst uns froh und munter sein.“ Plötzlich rief das Fräulein meinen Namen, ich erschrak. Der Nikolaus sah mich fragend an und da fiel es mir sofort wieder ein: ich durfte den goldenen Stab halten, damit er in seinem Buch blättern und lesen konnte. Wir wussten, dass jeder einzelne vorzutreten hatte und vom Nikolaus persönlich beschenkt wurde. „Hoffentlich fragt er mich nichts“, dachten wir insgeheim- aber auch das konnte vorkommen.
Ich hatte mich zwischen dem Nikolaus und Knecht Ruprecht zu stellen, das hatte ich mir gemerkt. Als ich stolz dastand, den goldenen Stab nun in meiner kleinen Hand, ließ es sich der Begleiter nicht nehmen, mir mit der Rute einen Klapps auf das Hinterteil zu geben. Näher rückte ich an den Nikolaus, der mir irgendwie vertraut vorkam; wie hieß es so schön: er sei ein Freund der Kinder! Ich wunderte mich, wie leicht sich der Bischofsstab anfühlte, hatte ich mir so einen Hirtenstab wesentlich schwerer vorgestellt.
Brummend und mit der Rute schwenkend machte Knecht Ruprecht, der im Gegensatz zu Bischof Nikolaus recht klein wirkte, auf sich aufmerksam. „Schon gut Knecht Ruprecht“, ließ sich der Nikolaus vernehmen „Fräulein Dobmeier hat mir gesagt, dass hier nur brave Kinder sitzen“. Ich war beruhigt und hörte aufmerksam zu, was sich der Nikolaus über jeden einzelnen notiert hatte.
Die Stimme des Nikolaus kam mir bekannt vor; na gut, dachte ich, letztes Jahr hat er uns auch besucht, deshalb kenne ich ihn ja.
Ich schaute in den Kreis der Kinder und sah meine Freundinnen, die sich mit roten Bäckchen über die Geschenktüten beugten. Die gute Frau Renner, die für uns kochte, redete beruhigend auf die Kinder ein, die sich ängstlich zeigten. Der Nikolaus und sein Geselle hatten viel Zeit für uns mitgebracht. Beide saßen nun in der Mitte des Kreises und hörten sich Gedichte und kurze Familiengeschichten an.
Traditionell beschenkten Knecht Ruprecht und der Hl. Nikolaus die Kinder mit Nüssen, Orangen, Mandarinen, Schokolade und Lebkuchen.
„So, jetzt kommt die Evi zu mir“, mein Herz schlug schneller und nun kam auch noch Knecht Ruprecht auf mich zu, um mir den Stab abzunehmen. Der Gedanke, dass der große Rupfensack so gut wie leer war, beschäftigte mich. Dann dachte ich daran, dass es immer hieß: „ Krampus verschleppt nur böse Buben“. Mit dem frohen Gedanken, ein Mädchen zu sein, trat ich vor den beeindruckenden Nikolaus und sah ihn an. Nun war ich wirklich überrascht, er trug die selbe Brille wie „unser“ Pfarrer, der dicke dunkle Rand und die Gläser, in denen ich mich spiegeln konnte und man nie die Augen des Menschen sah.
Auf dem Nachhauseweg, im Dämmerlicht und durch hohen Schnee sagte mir meine Mutter, dass morgen Abend der Nikolaus mich nochmal, und zwar zuhause besuchen käme. Ich war begeistert und erwartete selbstverständlich den gleichen Nikolaus wie im Kindergarten.
Am nächsten Tag wartete ich gespannt und malte mir aus, wie der Nikolaus in seinem roten Gewand zu uns in`s Wohnzimmer kommt.
Es war schon stockdunkel als Ketten rasselten und mein Vater mit dem Nikolaus im Hausflur erschien. Der Knecht Ruprecht sei draußen geblieben, weil ich doch recht brav über`s Jahr gewesen sei, erklärte mir mein Vater. Ich war etwas enttäuscht, denn dieser Nikolaus trug kein leuchtend rotes Gewand, sondern war in blau gekleidet. Er trug eine Brille und ich spiegelte mich nicht in den Gläsern, er war sehr groß, noch größer als wie der im Kindergarten und seine Stimme kannte ich nicht. Seit diesem Abend war ich davon überzeugt, dass es mindestens zwei Nikolaus geben musste.
Ich hatte fest vor, diesem Geheimnis nachzuspüren. Bei meinen Eltern hatte ich kein Glück; sie erklärten mir, dass der Nikolaus mit dem Flugzeug gekommen sei und da mein Vater in München Riem, in der Flugsicherung arbeitete, habe er ihn gleich gesehen und mitgebracht. Diese Auskunft genügte mir nicht und so befragte ich Freundinnen, die hatten keine Erklärung für das unterschiedliche Erscheinungsbild der Nikoläuse. Ich kam zu der Erkenntnis, es müsse weit mehr als wie zwei geben und vor allem müsse es jede Menge Knecht Ruprecht geben.
Mit meinen Fragen bin ich bei den Nachbarskindern Margit und Birgit angelangt und ich hatte mehr Glück. Die beiden gingen damals in die erste und zweite Schulklasse und das beeindruckte mich natürlich. Unter dem Siegel der Verschwiegenheit erzählten sie mir, dass es den Osterhasen nicht gibt, der Nikolaus und vor allem das Christkind jedoch „echt“ seien. Zutiefst beeindruckt und verwirrt musste ich diese Erkenntnis erst einmal verdauen. Ich konnte es nicht glauben, was ich da erfahren hatte und am nächsten Tag landete ich auf dem Schoß der Kindergärtnerin, von der ich hoffte, dass sie Licht in mein Dunkel bringen würde.
Auf Fräulein Dobmeier war immer Verlass. Sie war Single und eine begnadete Pädagogin. Selbst in ihrer Freizeit verbrachte sie viele Stunden im Kindergarten. Ihre Arbeit, ihr Beruf war ihr Leben! Sie machte die administrativen Belange, bestimmte den Speiseplan, sie machte einfach alles, was mit der Einrichtung zusammen hing. Bei der Dekoration bewies sie viel Geschmack und sie traf bei uns Kindern auf großes Interesse und förderte dieses gekonnt. Heute kann ich nur sinngemäß wiedergeben, was sie mir damals mit auf den Weg gab: „ Alles, was du siehst, ist echt. Woran du glaubst, wird dein Leben bestimmen. Es ist wichtig, dass man an sich selbst glaubt. Und es ist wichtig, dass du an Jesus, an die Mutter Gottes glaubst“. Ihre Lebensweisheiten habe ich mitgenommen; sie war wohl auch die Frau, die mich durch ihre Persönlichkeit unbewusst anleitete, den Beruf der Erzieherin zu ergreifen.
Niemand verstand es so wie sie, die geheimnisvolle Atmosphäre der Advents und Weihnachtszeit in die Gedanken und Herzen der Menschen, vor allem der Kinder zu zaubern, wie Fräulein Dobmeier.
Im Lichte der roten Adventskerzen wurde jeden Morgen die Krippenlandschaft erweitert, dem Jesuskind eine bequeme Krippe bereitet. Wir legten Strohhalme in die große Krippe und freuten uns sehr, dass am letzten Kindergartentag vor den Weihnachtsferien das Christkind seinen Platz eingenommen hatte und uns zulächelte.
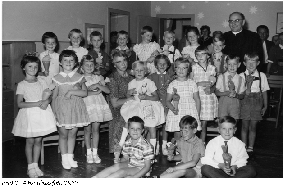 Wir
Kinder öffneten uns vertrauensvoll den Erzählungen der Erwachsenen, vor allem
der Kindergärtnerin. Gerade die Vorweihnachtszeit, die vielgepriesene „staade
Zeit“, war ein Highlight des Jahres.
Wir
Kinder öffneten uns vertrauensvoll den Erzählungen der Erwachsenen, vor allem
der Kindergärtnerin. Gerade die Vorweihnachtszeit, die vielgepriesene „staade
Zeit“, war ein Highlight des Jahres.
Obwohl, vielleicht besser weil es in den frühen 60er Jahren zumindest in Anzing noch keine festliche Straßenbeleuchtung, geschweige denn Schaufensterdekorationen gab, war im Dorf die geheimnisvolle Zeit so deutlich spürbar. Der ganze Ort war, spätestens um die Nikolaustage verschneit.
Wie in schneeweiße Watte gepackt präsentierten sich die alten Bauernhöfe. Um diese Jahreszeit war es ruhig im Dorf. Die lärmenden Bulldogs, die im Sommer das Straßenbild prägten, vor allem die lauten Lanzmaschinen, „schliefen“ in den Garagen oder Tennen. Die Zugmaschinen, die gemächlich vor sich hin tuckelten, hatten über den mächtigen Reifen Schneeketten aufgezogen.
Der gesamte Straßenverkehr war, im Vergleich zum heutigen Verkehrsaufkommen geradezu geringfügig. VW Käfer, Goggomobile, lärmende DKW, später kamen die schaukelnden Opel Rekord dazu, und gemütliche Motorräder prägten das Straßenbild. Der dichte Schneefall und die hohen Schneewände rechts und links der langgezogenen Dorfstraße schienen die Autogeräusche zu verschlucken. Die Hoegerstraße, die durch das Dorf führt, war links und rechts von Bäumen eingesäumt und nicht so breit, wie das heutige Ortsbild es uns zeigt.
Wir Kinder hatten eine tiefe Freude am Winter: Schneebälle flogen massenhaft durch die Luft und wir verabredeten uns zum Schlittenfahren. Es gab verschiedene Bergerl: für die Jüngsten stand das Öttlbergerl zur Verfügung. In Volksschuljahren bevorzugte man das Kandlerbergerl und wenn man „richtig groß“ war, nahm man den Weg Richtung Neufarn, zum Neufarner Berg, auch genannt: Schinderhüttn.
Für ein „Fünfzigerl“ konnte man sich mit Süßigkeiten eindecken, auch für ein „Zehnerl“ bekam man schon eine Anzahl der feinen, süßen Leckereien. Brausestangerl, Eiskonfekt und das gute Schöllereis, das es beim Faltermair zu kaufen gab, zählten zu meinen Favoriten. Anzing hatte zu jener Zeit eine überschaubare Zahl an Einwohnern und der Bürgermeister war ein gütig lächelnder Mann, Anton Herrmann.
Es gab jede Menge kleiner Lebensmittelgeschäfte; mein bevorzugtes Geschäft wurde von einer Person betrieben, der Reis Cence. Sie lebte in einem winzigen Haus, mitten im Dorf, gegenüber der Gaststätte „Alte Post“. Das Häusel steht schon lange nicht mehr. Bereits als Kindergartenkind fand ich den Weg zu ihrem kleinen Laden. Die alte Frau lebte alleine, ich weiß nicht, ob sie je verheiratet war.
Sobald man mit einigem Kraftaufwand, jedenfalls als Kind, die knarzende Ladentüre aufdrückte, bimmelte eine Glocke und man stand schon mittendrin, in dem kleinen, dunklen Verkaufsraum.
Wenn sich das Augenlicht an die Dunkelheit gewöhnt hatte, sah man die Guateln in der Bonboniere, direkt vor sich. Sogleich öffnete sich rechts vom Ladentisch eine Türe und die schlanke, meist in dunkel gekleidete Cence kam mit einem Lächeln auf dem Gesicht heraus. „Grüaß di Gott, was kriagst denn?“Auch wenn wir Kinder oft nur für ein „Fünferl“ Süßigkeiten erwarben, Cence war nie missmutig, im Gegenteil, sie legte immer noch etwas drauf!
Bereits auf dem Heimweg fasste ich in die Papiertüte und ließ mir die Süßigkeiten im Munde zergehen. Tauschgeschäfte blühten in jenen Tag, es war ja auch offensichtlich, wo ich herkam.
Heidi z. B. hatte einen anderen Favoritenladen; sie kaufte gut und gerne bei der „Hohenleitner“ Anne. Zugegeben, der Laden war etwas größer, aber mich trennte die gefährliche Bundesstraße 12 von dem Geschäft. Anzing ist ein Ort, der buchstäblich zweigeteilt ist und diese Teilung verursachte in früheren Jahren, vor dem Bau der Autobahn, die B 12. Als Kind hatte ich die strikte Anweisung, die Bundesstraße nicht zu überqueren. (Meist hielt ich mich daran)
So war es beschaulich im Dorf, vor allem in den Wintermonaten. Die Dorfgemeinschaften blühten und wurden stets erweitert. So existierte eine Theatergruppe und zur Faschingszeit und an Kathrein wurde das Tanzbein im Gackstattersaal fleißig geschwungen. Leider durfte ich den Gackstattersaal nicht mehr kennenlernen; ihn ereilte sehr früh das Schicksal, geschlossen zu werden. Keine zwei Jahrzehnte später wurde auch der Finauersaal, in dem wunderschöne Bälle, z. B. der Sportlerball gefeiert wurden, ebenfalls geschlossen.
Viele meiner Generation verbinden das erste Schmusen, wahrscheinlich die Erste Liebe mit dem Finauersaal. Das Dorfleben blühte, es war eine Selbstverständlichkeit sich am guten Gelingen zu beteiligen, sich in den Vereinen zu integrieren und zu engagieren. Jeder hatte einen festen Platz in der dörflichen Gemeinschaft. Es herrschte Aufbruchstimmung; wie in den umliegenden Dörfern auch, war „Stress“ ein absolutes Fremdwort.
Meine Freundin Renate erzählte mir, dass es guter Brauch war, in der Adventszeit im Wohnzimmer ihres Elternhauses zusammen zu kommen und sich musikalisch auf Weihnachten einzustimmen. Natürlich gehörten ein oder zwei Glas Bowle dazu und jeder hoffte, die Hausfrau würde eine „Plätzchenprobe“ gestatten. Selbstgedichtetes gehörte dazu und manch einer brachte sein Instrument zum Einsatz. Die Freude, nach den Kriegsjahren zu mehr oder weniger Wohlstand gekommen zu sein, solch ein unbeschwertes Leben führen zu können, Freunde zu haben und Feiern zu dürfen, vor allem das Christfest in der Familie begehen zu dürfen, stand den Leuten in`s Gesicht geschrieben.
Nirgends war vor dem 24.12. ein erleuchteter Christbaum zu sehen. Erst an diesem Abend, den wir Kinder so sehnsüchtig erwarteten, erstrahlten in den Häusern die geschmückten Bäume.
Irgendwann in der Adventszeit stand ein zusammengeschnürter Fichtenbaum in unserem Freisitz. Viele Jahre sah ich den Baum gar nicht, weil ich im Winter nicht in diese Ecke des Grundstückes kam. Die Winter waren in der Anfangszeit in Anzing so streng, dass mein Vater die Türe, die zur Terrasse führte von außen verschloss. Die Fensterfront reichte in der Winterzeit vollends.
Bereits im Kindergartenalter war es üblich, an Sonn.- und Feiertagen in die Kirche zu gehen. Unsere Kindergärtnerin führte uns öfter einmal in die schöne Anzinger Marien Wallfahrtskirche.
Die Kindergartenkinder hatten ihre Plätze ganz vorne, daran schlossen sich die Erstklässler an. Was auch konsequent eingehalten wurde, war, dass die Mädchen und Frauen im Kirchenschiff links und die Buben und Männer rechts Platz nehmen. Das lockerte sich erst in den vergangenen zehn Jahren etwas auf.
Zu jener Zeit gab es in Anzing den modernen Altartisch, an dem der Priester die Messe, dem Volk zugewandt liest, noch nicht. Und noch etwas war undenkbar: die Messe in deutscher Sprache zu halten. Der Gottesdienst wurde in lateinischer Sprache gehalten, lediglich die Ansprache der Predigt war deutsch. Es war also fürchterlich langweilig für uns Kinder, den Pfarrer nur von hinten zu sehen und kein Wort zu verstehen. So lag es auf der Hand, dass man sich mit seiner Banknachbarin in ein Gespräch vertiefte. Das konnte üble Folgen haben. Manch ein Erwachsener hielt sich für befugt, einzugreifen. So kam es öfter vor, dass Erwachsene in die Kinderbänke gingen und den schwätzenden Kindern eine schallende Ohrfeige verpassten. Mehr als einmal sah ich Buben heulen, wenn sie handgreiflich abgemahnt wurden. Was noch schlimmer war, ist die Tatsache, dass unser Pfarrer sehr wütend werden konnte. Gefürchtet für seine Ausbrüche verließ er nicht nur einmal den Altar, um ein Kind während der Messe zu ohrfeigen. Meistens erwischte es die Buben, ich kann mich an keinen Fall erinnern, wo Mädchen geohrfeigt wurden.
In der Hierarchie jener Aufbruchjahre stand ein Dorfpfarrer ganz oben, gefolgt vom Bürgermeister und den Lehrkräften. Unser Fräulein Dobmeier stand ebenfalls in dieser Riege.
Jedes Kind hatte ganz automatisch gelernt, die Autoritäten anzuerkennen. Das ging nicht ohne Ängste ab und so wurden oft schon im frühen Kindesalter Ängste entwickelt die Jahre später erst erkannt und behandelt wurden. Es gab zur damaligen Zeit, wie auch heute viele Erwachsene, die sich die Ängste der Kinder zunutze machen, und die Kinder schändlich missbrauchen. Persönlich bin ich nicht betroffen, aber ich kenne einige Altersgenossinnen, die autoritären Erwachsenen zu Opfern wurden. Die wenigsten Kinder vertrauten sich mit ihren Gewissenskonflikten den Eltern an, denn diese stellten ja auch Autoritäten dar. „Wenn`st vom Lehrer a Watsch`n kriagt hast, brauchst des dahoam gar net erzähl`n, denn dann fangst glei nochmal oane“, dies war eine ernstzunehmende Aussage, die wir befolgten. Was Erwachsene taten, war von uns Kindern nicht zu kritisieren, basta!
Ich kenne einen besonders krassen, traurigen Fall der sich nicht in Anzing und der näheren Umgebung zutrug, sondern in einem Nachbarort, aus Erzählungen. Ein junges Mädchen wurde jahrelang vom Bruder des Vaters sexuell missbraucht. Der Onkel war auf dem Hof geblieben, hatte nie geheiratet und missbrauchte seine Nichte fast täglich. Das Kind wagte nicht, den Eltern von den unheimlichen nächtlichen Besuchen zu erzählen und vertraute sich mit ca neun Jahren im Beichtstuhl dem Seelsorger an. Dieser antwortete ihr: „ Des is net so schlimm, dann bleibt des ois in der Familie“.
Meine Streiche, meine Probleme, waren überschaubar und die Erwachsenen, die mit begegneten, waren gütige Menschen.
Mit meinen Freundinnen musste ich öfter am Samstag, und zwar jeden Samstag den Rosenkranz beten. Die Glocken des Kirchturmes riefen die Bevölkerung, und vor allem ältere Frauen folgten diesem Aufruf. In der Ringstraße wohnten mehrere Omas, die in der Familie eine große Aufgabe zu erfüllen hatten, sie versorgten die Enkelkinder, während die Mütter bzw die Töchter einer Arbeit außer Haus nachgehen konnten. Wie sich jeder vorstellen kann, hatten meine Freundinnen und ich oft keine Lust, den Rosenkranz in der Kirche zu beten; es war entsetzlich langweilig für uns. Also, „schwänzten“ wir und dazu diente uns das „Amselwegerl“. Das „Amselwegerl“ gibt es nicht mehr, es hat sich in ein Siedlungsgebiet verwandelt und heißt nun Amselweg. Damals war es ein schmales Wegerl, man konnte gerade mit dem Rad durchfahren, bei Gegenverkehr musste man absteigen und sich aneinander vorbei zwängen. Unmittelbar an das Wegerl waren Holzscheunen und Schuppen gebaut. So machten wir uns mit dem Rosenkranz auf den Weg von zuhause und bogen in das besagte Wegerl ab. Heute sollte es besonders interessant werden, denn eine Freundin hatte Zigaretten und Streichhölzer mit dabei! So standen wir im Wegerl und fühlten uns „richtig groß“. Plötzlich tauchte vor uns eine Nachbarin, eine für unser Empfinden schon recht alte Frau auf. „Ja, ihr Luda, was treibt`s denn ihr da?“. Der Rosenkranz baumelte uns aus den Taschen und sie hat die Situation sofort erfasst. „Schaut`s net glei, dass ihr in die Kirch kommt`s!“ Erschrocken drückten wir die Zigaretten, die uns sowieso nicht schmeckten, aus, und machten uns auf den Weg, der gar nicht mehr weit war. Kurz bevor wir die Straße überqueren mussten, rief sie uns noch nach: „ Ihr braucht`s net Angst ham, euere Eltern erzähl i nix“. Sie hat Wort gehalten, das habe ich ihr nie vergessen. Nach dem Rosenkranz ging sie nochmal auf uns zu und sagte: „ Auch wenn`s eich heit furchtbar langweilig war, ihr werd`s seng, a ihr kummt`s in a Alter wo eich der Rosenkranz g`fallt. Beim Rosenkranz konn ma so sche nachdenga“, auch mit dieser Aussage hat sie recht behalten!